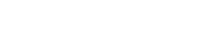General information
| Course name | Basisseminar/Proseminar: Basisseminar 1.1 - Das Eckenlied |
| Subtitle | |
| Course number | 4513218 |
| Semester | WiSe 2024/25 |
| Current number of participants | 20 |
| maximum number of participants | 20 |
| Home institute | Abteilung Germanistische Mediävistik (Ältere Deutsche Sprache und Literatur) |
| Courses type | Basisseminar/Proseminar in category Teaching |
| First date | Monday, 21.10.2024 12:15 - 13:45 |
| Type/Form | |
| Performance record |
→Ab hier automatisch erfasste Informationen / Beyond this point, the information is filled in automatically← Prüfungsleistung(en) je Modul / Exam details per module: * [(B.Ger.01-1.3) Basisseminar Mediävistik 1.1][1] * Mündlich: Mo, 03.02.2025, von 09:00:00 bis 12:00:00 * Mündlich: Di, 04.02.2025, von 09:30:00 bis 11:00:00 * Mündlich: Mi, 05.02.2025, von 09:00:00 bis 10:00:00 * Mündlich: Do, 06.02.2025, von 09:00:00 bis 12:00:00 * Mündlich: Fr, 07.02.2025, von 09:00:00 bis 12:00:00 * [(B.Ger.01-1.ExMed-3C.Mp) Basisseminar Mediävistik 1.1][2] * Mündlich: Fr, 07.02.2025, von 09:00:00 bis 12:00:00 * [(M.Ger.27.PrVor) Einführung Mediävistik 1.1][3] * Prüfungsvorleistung: Mo, 31.03.2025 [1]: https://ecampus.uni-goettingen.de/h1/pages/startFlow.xhtml?_flowId=detailView-flow&unitId=43543&periodId=277 [2]: https://ecampus.uni-goettingen.de/h1/pages/startFlow.xhtml?_flowId=detailView-flow&unitId=63930&periodId=277 [3]: https://ecampus.uni-goettingen.de/h1/pages/startFlow.xhtml?_flowId=detailView-flow&unitId=44109&periodId=277 |
| Miscellanea |
Willkommen im Studium der Germanistik! Das Basisseminar Mediävistik soll es Ihnen ermöglichen, die deutsche Sprache und Literatur in ihren medialen und kulturellen Bedingungen von Anfang an zu studieren. Dazu möchten wir Sie einführen in die eigenständige Lektüre und Diskussion von Texten und Vorstellungswelten, die den historisch größten Teil der deutschen Sprach- und Literaturgeschichte ausmachen und gerade heute in der populären Kultur ständig wiederkehren. So ist das Mittelalter in Filmen und Computerspielen ebenso präsent, wie sich die romantischen Märchenwelten an einer zentralen Stelle der neueren deutschen Literaturgeschichte auf das Mittelalter beziehen. Dieses Mittelalterbild war immer schon eine große literarische Erfindung, in der sich die Entstehung von Literatur entdecken lässt. Die erste, wissenschaftliche Anlaufstelle zu dieser Entdeckung ist die mittelalterliche Literatur selbst. Das Basisseminar Mediävistik 1.1 führt anhand ausgewählter Texte in die deutsche Sprache und Literatur des Mittelalters ein, die gemeinsam gelesen und diskutiert, mit den grundlegenden wissenschaftlichen Hilfsmitteln erschlossen und anhand von einführenden Forschungsbeiträgen analysiert werden. Damit wird ein erster Zugang zur mittelhochdeutschen Sprache und zu den Hauptgattungen der mittelalterlichen Literatur eröffnet, es werden aber auch wissenschaftliche Arbeitstechniken, Begriffe und Präsentationsformen eingeübt, mit denen Sie ihre Kenntnisse im weiteren Studium der Germanistik eigenständig und historisch fundiert ausbauen können. In diesem Seminar wollen wir der merkwürdigen Geschichte eines riesenhaften Helden nachgehen und dabei ersten Kontakt mit dem Mittelhochdeutschen aufnehmen. Das Eckenlied, dessen Entstehungszeit auf die erste Hälfte des 13. Jahrhunderts angesetzt wird, erzählt von dem Riesen Ecke, der sich mit dem berühmten Dietrich von Bern im Kampf messen will. Bevor er auszieht, um diesen zu suchen, wird er von drei Königinnen mit einer goldenen, unzerstörbaren Rüstung ausgestattet, deren Geschichte zu Beginn der Handlung resümiert wird. Ecke macht sich, was im Folgenden noch zu einigen Irritationen führen wird, unberitten auf den Weg und begegnet Dietrich schließlich im Wald. Dort kommt es nach langem Wortgefecht schließlich zum Zweikampf. Ecke unterliegt und wird von Dietrich getötet, der seine Tat sogleich beklagt, die geheimnisvolle Rüstung sowie Eckes Kopf an sich nimmt und fortreitet. Es schließen sich verschiedene âventiuren an, die Dietrich zu bestehen hat. Zuletzt erreicht er den Ausgangspunkt der Handlung, sucht die Königinnen auf, die Ecke ausgesandt hatten, und schleudert ihnen unter starken Vorwürfen das Haupt Eckes vor die Füße. Das in sieben Handschriften und elf Drucken überlieferte Eckenlied ist der sog. âventiurehaften Dietrichepik zuzurechnen und zeichnet sich, wie viele Texte der späten Heldenepik, durch eine komplexe Überlieferungslage aus. Es existieren verschiedene, z.T. stark voneinander abweichende Fassungen, die wiederum zahlreiche inhaltliche Querverbindungen zu anderen heldenepischen Texten aufweisen. So treten im Eckenlied der aus dem Nibelungenlied bekannte Dietrich von Bern sowie sein Waffenmeister Hildebrand, aber auch die aus den Ortnit/Wolfdietrich-Epen bekannte unzerstörbare Rüstung in Erscheinung, die ihre Träger zwar nicht vor dem Tod schützen, dafür aber über Textgrenzen hinwegwandern kann. Das Eckenlied kombiniert unterschiedlichste Erzählelemente aus Epik, Märchen und höfischem Roman. Diese spezifische Offenheit gegenüber narrativen Schemata aus verschiedenen Gattungskontexten bleibt allerdings nicht ohne Konsequenzen für die Interpretation des Eckenliedes und seinen einzelnen Fassungen. Diese Interpretationsprobleme wollen wir im Seminar anhand ausgewählter Forschungsbeiträge diskutieren. Sprechstunde: nach Vereinbarung per Email (mmuelle9@gwdg.de) Lektüre: Ein Reader mit den zu lesenden Primär- und Forschungstexten wird Anfang des Semesters über StudIP online bereitgestellt. Zur Einführung: Joachim Heinzle: Art. ‚Eckenlied‘, in: Verfasserdatenbank, Berlin/New York 2012 (online): < https://www-1degruyter-1com-1gzs214320017.han.sub.uni-goettingen.de/database/VDBO/entry/vdbo.vlma.0853/html > |